
31 Dec Kolumne: Lost In Music
Durchs Unterholz großer Alben der Pop-Musik mit Wünschelroute, Tricorder und Buchwissen. In 50 Teilen.
(Kolumne erschienen in The Gap 2006-2011)
Lost in Music – Nr.4
DJ Pierre
DJ Pierre (Strictly Rhythm, 1994)

Diese Zusammenstellung von Tracks der Jahre 1991-94 würde trotz ihrer Klasse kaum ans Licht dieser Rubrik gezerrt werden, wenn DJ Pierre nicht zuvor schon Körperbewegendes geleistet hätte. Doch bei Clubmusik stößt jedes Projekt einer Erkundung von Popmusik, das sich an das Vermarktungskonzept „Album“ hält, an seine natürlichen Grenzen. DJ Pierre gilt mit seinem Partner Spanky als Erfinder von Acid House. Sie brauchen allerdings kein Album, um das Schalten der Synapsen im kurzweiligen Clubbetrieb zu revolutionieren. Es genügt, dass sich ein einziger Club 1986 in Chicago ihres „Acid Tracks“ annimmt und damit Geschichte schreibt: Ron Hardy’s Music Box.
Anfangs überhaupt nur als Tape gespielt, ist der unter dem Pseudonym „Phuture“ veröffentlichte Track für den für Acid House typischen Sqelch-Sound verantwortlich. Dieser entsteht durch einen Unfall, als der Bass-Synthesizer TB-303 der japanischen Firma Roland in extreme Pitchlagen gebracht wird. Vereinzelt hatten das bereits andere Chicagoer Artists gemacht, doch Phuture bringen zusätzliche Bewegung in die Musik, indem sie während des Tracks an den Filtern dieses kaputten Sounds drehen. Ihr Handwerk hatten die beiden nicht gelernt. Deshalb klingt „Acid Tracks“ nicht so, wie es den üblichen Vorstellungen von Musik entspricht. Sondern roh, dissident und futuristisch. Die gerade Bassdrum und fremde, entmenschlichte Geräusche bringen die Zukunft auf den Dancefloor. Und weil DJ Pierre die geheime Zutat des Acid-Sounds sehr unkompliziert weitergibt, sieht sich Chicago bald mit einer Schwemme ähnlicher Platten konfrontiert, die in kürzester Zeit auch New York und Britanniens junge Rave-Szene prägt. Mit strengeren Copyrights wäre es dazu nie gekommen. So aber hatte die halluzinogene, experimentelle Variante des House seinen charakteristischen Sound gefunden, der seither in unregelmäßigen Wellen aktueller Clubmusik seine brutzelnden Impulse injiziert.
Dieses Album nun beginnt mit dem 1991 entstandenen „Generate Power“, das Elemente des Acid House weiterentwickelt und gleichzeitig ein eigenes Subgenre lostritt. Hypnotisch und repetitiv schraubt er sich langsam in Richtung einer unterkühlten Intensitivität. Und ähnlich dem Sqelch-Sound sorgt hier ein schnell zurückgedrehtes Sample als ein konstantes, modulierendes Geräusch für den Trance-Effekt. Wild Pitch nennt sich der Abkömmling, der für einige Jahre zum neuen Produktionsstandard wird. Auch die restlichen Tracks bestechen durch Reduktion und eine einzigartige Kombination mit Splittern anderer Dance-Genres. Filtertechnik und Vocal-Samples ordnen sich dem fließenden Pumpen unter und versorgen in langen Bögen einen unaufhaltbaren Drive. Zwar klingt das nicht mehr ganz so radikal wie frühe Acid-Tracks, verzahnt aber Vergangenheit und Zukunft und schafft es wie sonst kaum eine Musik mit dem eigenen Zeitempfinden spazieren zu fahren. „DJ Pierre“ stellt die einzige Möglichkeit dar, in gebündelter Form mit auf diese Adventures in Wild Pitch zu gehen. Auf Amazon bereits ab Euro 58.00!
Lost in Music – Nr.11
M.I.A.
Arular (XL Recordings, 2005)

Mit M.I.A. bricht die Welt in die Festung Europa ein. Das Debüt von Maya Arulpragasam wirbelt eine ganze Menge weltweit verstreuter Stile durcheinander. Bhangra, Baile Funk, Miami Bass, Grime und Dancehall sind nur ein Teil der Zauberzutaten von „Arular“. Die Tochter eines hohen, tamilischen Rebellen lebt bis sie elf wird zwischen Indien und Sri Lanka. Dann der Umzug in eines der Armenviertel Londons, wo sich den Großteil ihrer Jugend vor allem darum kümmert, welcher Sneaker der coolste der kommenden Saison werden würde. Irgendwie schafft sie es in das Kunststudium des renommierten St.Martins College und wird von ihrer lang stillgelegten, politisch geladenen Vergangenheit wieder eingeholt. Ihre Patchwork-Biografie passt zu ihrer Patchwork-Arbeitsweise. Kunst, Armut, Politik, aber auch Style stehen bei M.I.A. dicht beieinander. Dabei positioniert sich M.I.A. eindeutig auf der Seite der Medienlosen. Die Unterdrückten, die durch Geld Beherrschten, die Working Poor erhalten durch sie eine Stimme.
Ganz gezielt wählt sie dafür das sehr einfach gebaute Pidgin-Englisch, das möglichst überall, aber auch von den richtigen Leuten verstanden werden soll. Im Code des Lumpen-Esperantos textet sie über Ausbeutung, Heimatlosigkeit und das andere Ende von Freiheit. Ihre Stimme ist fordernd, durchrüttelnd und zwingend. Die Musik dazu verwendet die Rhythmen einer globalisierten Diaspora; emigrierte Beats, die bereits ihren Weg durch die technologische Verfremdung gegangen sind. Auch die meisten Sounds sind „halbakustisch“ – synthetisierte Alltagsgeräusche und Straßenlärm, die brillant collagiert und zu wilden, sonischen Flächen arrangiert werden. „Arular“ ist voll von entstellten, chaotischen Geräuschen einer Reise um den Globus; oder auch nur aus einem der Brennpunkt-Bezirke einer beliebigen westlichen Großstadt. Und so wie immer bei großer, politischer Kunst bleibt auch hier offen, ob ihr Ziel nun Politik oder Kunst ist. Zweifelsohne arbeitet sich hier aber tatsächlich jemand am Verhältnis von Gewalt, Guerilla und den Versprechungen westlicher Menschen- und Konsumrechte ab. Manchmal sehr offen, an anderer Stelle maskiert oder von harmlosen Party-Slogans umgeben.
Mit M.I.A. bricht die Welt in die Festung Europa ein. Doch diese Welt ist nicht mehr urwüchsig, rein oder beschaulich wie in einem Dritte-Welt-Laden. Die Weltmusik dort will meistens einen gefährdeten, authentischen Zustand konservieren; sie will die Differenz zwischen dem Eigenen und dem Exotischen auskosten. Die Welt der M.I.A. dagegen ist schon längst vom Westen überwuchert und in ein zunehmend schwerer unterscheidbares Hin und Her von Zeichen verstrickt. Mit M.I.A. bricht die Welt in die Festung Europa ein. Ihre Widersprüche sind auch die unsren.
Lost in Music – Nr.18
Kate Bush
Hounds Of Love (EMI, 1985)

Aus gut bürgerlichem Haus kommend, fällt der Beginn von Catherine Bushs Karriere in jene Zeit der Siebziger, in der für Plattenfimen noch reichlich Geld mit progressiver Musik zu verdienen war. 1975 bekommt sie auf Empfehlung von David Gilmour (Pink Floyd) mit sechzehn Jahren eine Art Labelstipendium von EMI. Sie nimmt etwa 200 Demosongs auf, macht ihren Abschluss und nimmt Stunden in Pantomime und Tanz. Als „Wuthering Heights“ im Jänner 1978 auf die englische Eins einschlägt, ist sie überhaupt die erste Frau, die das auf der Insel mit einem selbstgeschriebenen Song schafft (was sie zwei Jahre später auf dem Albumsektor mit „Never For Ever“ wiederholt). Zur selben Zeit fegt Punk über die Köpfe der letzten Gitarren-Akademiker hinweg und hinterlässt ein Trümmerfeld aus neuen Möglichkeiten. Vor dem Hintergrund der vokalen Extremlagen von Punkbands wie den Slits oder X-Ray Spex klingt Kate Bushs hoher Sopran eindrucksvoll, aber nicht ungewöhnlich. Gleichzeitig setzt sie der Anarcho-Frustration eine sehr artifizielle Welt entgegen, die voll von bizarren Geschichten ist und sich extensiv mit Gefühlen in all ihren Schattierungen auseinandersetzt.
Gerade als viele Kritiker ihre Zeit nach dem mäßig erfolgreichen fünften Album „The Dreaming“ gekommen sehen, setzt Kate Bush mit „Hounds Of Love“ ihr ausgereiftestes Zeichen und etabliert sich damit erstmals auch in den Vereinigten Staaten. Geteilt ist das Album durch die zwei natürlichen Seiten des Vinyls – in das von experimentellen Popsongs geprägte „Hounds Of Love“ und den Liederzyklus „The Ninth Wave“, der sich um die Reise einer Ertrinkenden durch das kollektive Unterbewusste dreht. In ihren Videos entwirft Kate Bush dazu Räume, die einer unbekannten Logik zu folgen scheinen. Häufig sind diese Räume fast entleert – aber in ihnen verdichten sich mysteriöse Bilder menschlicher Konflikte. Tanz, Bewegung, Musik und Licht vermengen sich tendenziell zu einer Einheit; und Kate Bush entwickelt eindringliche visuelle Personas, die wieder in die Musik zurückgeworfen werden. Ihre hohe Bildschirmpräsenz trägt in der ersten Blütezeit des Musikfernsehens noch zusätzlich zu ihrem internationalen Ausnahmestatus bei.
Aufgenommen hat Kate Bush „Hounds Of Love“ in völliger Eigenregie in ihrem neu eingerichteten Heimstudio. Nie zeigt sie Berührungsängste mit der technischen Seite von Musik: als eine der Ersten verwendet sie einen polyphonen Sampler von Fairlight, oder auch ein Headset-Mikro um live die nötige Bewegungsfreiheit für ihre Tanz-Choreografien zu haben. Sie experimentiert mit ansonsten weniger verbreiteten Instrumenten und lässt sich von verschiedenste Einflüsse inspirieren. Das gilt für Genres ebenso wie für Kunstbereiche. Neben Kate Bushs Vorbildfunktion als starke und erfolgreiche Frauenfigur und dem Umstand, dass sie in ihren Texten häufig weibliche Perspektiven forciert, legitimiert sie darüber hinaus dauerhaft einen exzentrische Einsatz der Stimme. Nicht nur Björk kann davon einige Lieder singen.
Lost in Music – Nr.26
Michael Mayer
Immer (Kompakt, 2002)

Im Kontinuum von Techno hat Minimal eine lange und verworrene Geschichte. Und kaum ein Ort ist so eng damit verwoben wie Köln. Häufig wird seine Entstehung zwar mit Robert Hoods 1994er-Album „Minimal Nation“ verknüpft, doch auch in Köln legen Dr. Walker und vor allem Mike Ink gleichzeitig wichtige Grundlagen für den Stil. Nur wenig später ist bereits von einem nebulösen „Sound Of Cologne“ die Rede. In der allgemeinen Begriffsverwirrung hängt sich 1997 das neu gegründete Label „Kompakt“ anfangs noch bereitwillig die Minimal-Glocke um. Da schwächelt das vom Musiksender Viva propagierte Megarave-Deutschland bereits. Währenddessen nehmen Magazine wie De:Bug und Spex stattdessen die Ränder elektronischer Musik, wie Clicks’n’Cuts und Glitch-Musik, auf ihr Radar.
In diesem Umfeld etabliert sich die gleichzeitig avantgardistische und tanzbare Sound-Palette von Kompakt. Mit dieser mischt der Co-Gründer des Labels Michael Mayer seit 1998 das Publikum im legendären „Studio 672“ warm. Das Gefühl von „Immer“ soll gerade diese Zeit des späten Warm-Ups widerspiegeln und kommt (direkter als Mayers gefeierter Fabric 13-Mix) aus dem Club. Entgegen dem seriösen Purismus anderer Techno-Labels sucht Mayer eine persönliche Note. Er bringt Genres unter dem Vorzeichen von Techno zusammen und lässt auch ein Grundgefühl von Pop in seine Mixes einfließen. Einmal abgesehen davon, dass „Immer“ perfekt (analog) gemischt ist und Dynamiken bespielt, nützt Mayer dort außerdem die Einzigartigkeit von Mixtapes aus – nämlich in der Zeit die Facetten einer eigenen Welt aufzuspannen. Erst im Prozess des Mischens verbinden sich Samples und Einflüsse zu einem neuen Ganzen. Hier auf „Immer“ definiert und markiert Mayer einen Punkt, von dem aus Köln mit dem Aushängeschild Kompakt – als Vertrieb und Label – auch international immer prägender wird. 2002 ist das Jahr der kurzen Blüte von Electroclash. Über diesen Umweg schleichen sich ganz allgemein wieder klassische Rockstrukturen in den Dance-Kosmos ein. Dies wiederum kommt dem undogmatischen Stil von Michael Mayer, wie auch Kompakt entgegen.
Angeblich braucht Techno für seine Entwicklung die post-industriellen Wüsten von Städten wie Detroit, Manchester oder Lille. Köln dagegen liegt höchstens am Rand des grauen Ruhrpotts und kann stattdessen eine lange Tradition im Bereich elektronischer Musik, aber auch in Kunst und Medien vorweisen. Unter diesen Bedingungen konnte sich das familiäre Unternehmen Kompakt prächtig entfalten. „Immer“ ist als eine der herausragendsten Veröffentlichungen aus Köln dabei zugleich ein Abgesang auf hedonistischen Teutonen-Techno, wie auch auf die mit postmoderner Theorie überladene Soundexperimente der Neunziger. „Immer“ bildet, positiv gewendet, aber auch den originären Spannungsbogen für den Neustart von Minimal in den Nuller Jahren. Hier noch in einer arrangierten Sammlung von Grooves, Mikrogenres und Möglichkeiten.
Lost in Music – Nr.29
Slayer
Reign In Blood (Def Jam, 1986)

Thrash Metal kommt von Prügeln. Und das tun Slayer auch. Kaum eine Band trommelfeuert 1986 so wie Slayer in einem derartig atemberaubenden Tempo und entwickelt dabei trotzdem Groove. Genau 1986 legen die südkalifornischen Bands Metallica, Megadeath und Slayer die Grundfesten des Ultra-Dresch-Genres aus. Was dabei neu ist: die Härte, die Brutalität, die Drastigkeit der Bilder. Aber auch was bis vor kurzem noch scharf getrennt war, geht insbesondere bei Slayer und ihrem Major-Label-Debüt „Reign In Blood“ eine unerwartete Verbindung ein: auf das dritte Album von Slayer können sich sowohl Fans der Metal-Schule, wie auch Punks und Hardcore-Anhänger einigen. Es bietet vorwiegend peitschendes Schwermetall, aber es übernimmt auch Strukturen und den Minimalismus von Hardcore. Darüber hinaus ist es eines der wenigen Alben, das – wohl auch durch die Mitarbeit des bis dahin ausschließlich HipHop-produzierenden Def Jam-Mitbesitzers Rick Rubin – über die Metal- und Punk-Genregrenzen hinaus stark erweiterte Aufmerksamkeitskreise zieht.
Ein Grund dafür sind sicher auch die häufig kritisierten, skandalträchtigen Bildwelten von Slayer. Slayer bilden das Böse ohne Zeigefinger ab; doch nicht etwa das ganz alltäglich Böse, sondern überzeichnete Welten aus Blut und Mord – im Eröffnungstrack auch mal mit Geschichten vom Metzler von Auschwitz Josef Mengele. Das argumentative Ringelspiel von Abbildung von Gewalt zum Aufruf zur Nachahmung (und zurück) bekommt Slayer dabei ebenfalls zu spüren. Der Parental Advisory Sticker ist 1986 gerade druckfrisch im Umlauf. Der Vertriebspartner Columbia ist in Klagen zu Teenager-Selbstmorden verstrickt und winkt ab. Slayer bedeutet medialen Skandal. Dabei gehört die Logik des Skandals selbst zur Funktionsweise von Medien. Öffentlich subventionierte Gewalt und private Blutbäder werden über alle Medienkanäle abgefeuert. Diese sich gerade verstärkende, multimediale Reizüberflutung wird im Thrash Metal in gesteigerte Lautstärken, Tempi und möglichst ungebremste Sounds umgesetzt. Und in zunehmend blutrünstige Miniaturepen aus irdischen und mythischen Katastrophen.
„Reign In Blood“ ist dabei erstmals aufwändig und professionell produziert wie eine seriöse Rockplatte. Das Album lässt keine Ironie zu – es muss ernst genommen werden. Insofern weist es weit über sich hinaus und setzt gleichzeitig eigene Standards: für Death Metal überhaupt, für die Double-Bass-Frequenz anderer Drummer, für Nägel-bewehrte Lederkleidung, für eine sehr körnig-grobschlächtige Soundästhetik (fast) ohne jeden Hall-Effekt oder für die zunehmende Verwendung von kryptischen Lexikon-Begriffen in Songtexten. In 29 Minuten verbrennen Slayer mehr Erde als andere in Jahrzehnten. Sie bleiben immer Herr in ihrem Hochgeschwindigkeits-Parcour, sie kontrollieren in Sekundenbruchteilen das Werden und Vergehen von Songs. Slayer sind die Meister des sonischen Blutrauschs.
Lost in Music – Nr.30
Brian Eno
Ambient 1: Music For Airports (EG, 1978)

Im Jahr 1975 liegt das Ex-Roxy Music-Mitglied Brian Eno nach einem Autounfall durch einen Gips eingeschnürt im Krankenhaus und erspinnt dabei Ambient Musik. Dem kurz danach erscheinenden Album „Discreet Music“ sind Schalt-Skizzen seiner depersonaliserten Kompositionsweise beigelegt. Die Töne darauf sollen Hospitalsräume mit anspruchsvollen, aber unaufdringlichen Soundlandschaften füllen. So will es zumindest die Version der Geschichte, die an das Genie Brian Eno glaubt. Doch Eno hatte Vorläufer und Geistesverwandte (Erick Saties Musique d’Ameublement, Minimal Music, diverse Krautrock-Experimente). Insofern die Ausarbeitung einer Musik, die von geschäftiger Routine erfüllte Räume mit subtilem Sinn erfüllen soll, alleine noch nicht bahnbrechend. Erst „Music For Airports“ führt drei Jahre später dieses Prinzip zur konzeptionellen Vollendung – erst dieses Album führt klare Begriffsumrisse für das Wort „Ambient“ ein.
Muzak, akustische Tapete oder New Age sind nicht Ambient. Denn Ambient Musik soll für ganz bestimmte Orte geschaffen werden und die Wahrnehmung dieser Räume erweitern und schärfen. Sie soll wie öffenliche Kunst auf einer akustischen Ebene funktionieren. Eno geht es dabei um die Gestaltung, um ein Design von öffentlichem Raum, auch um das Schaffen von kontemplativen Zonen darin. Ambient verändert den gewohnten akustischen Fluß. Dieses Konzept steht nicht nur dem relativ jungen Fuhrpark elektronischer Sounds in der Kreide; es baut auch auf verfeinerten Soundmanipulationstechniken auf – wie Endloshall, Sampling, Loops, EQs zum neu Abmischen (also Remixen). Schon früh hat Eno eigene (Tonband-)Techniken entwickelt, die er hier bündelt. “Music For Airports” spiegelt zudem sich verändernde, akustische Alltagswelten wider. Mit der Verbreitung von billigen Beschallungssystemen wird erst ihre Subversion möglich. Den Einsatz klassischer Musik oder sehr hochfrequenter Sounds zur sonischen Abwehr von unerwünschtem Gesocks hatte Eno da sicher noch nicht im Hinterkopf. Dafür ist Ambient gerade in Filmen und Games zu einem unabkömmlichen, atmosphärischen Baustein geworden.
Brian Eno hatte sich immer als Nicht-Musiker verstanden und dennoch zahlreiche Stile angedeutet und vorweggenommen. Punk, Techno, New Age, Metal, Postrock, World Musik – sie alle führen in mehreren Strängen aus dem teils experimentellen, teils poppigen Werk Enos heraus. Als Produzent und Co-Musiker verhalf er vielen Artists zu ihren am höchsten angesehenen Alben. Für Microsoft verknappte er dann 1994 die Idee von Ambient auf drei Sekunden: ein inhaltlich bestimmter Raum wurde für den Begrüßungssound von Windows 95 mit jedem Login abgerufen. Sound Logos folgten unter anderem daraus. Und “Music For Airports” liefert dafür die Kernidee.
Lost in Music – Nr.34
Ray Charles
Modern Sounds in Country and Western Music (ABC, 1962)

Bei diesem Album sind viele Kommentatoren bei der Wahl ihrer Worte nicht zimperlich: historische Tragweite, ein Meilenstein, keine Platte hätte mehr zur Integration US-amerikanischer Musik beigetragen, Menschen und Hautfarben zusammen gebracht. Noch dazu ist sie eine der erfolgreichsten von Ray Charles.
Acht Jahre zuvor, schon 1954, entwirft der blinde Ray Charles Robinson den Prototyp von Soul. Auf Tour läuft im Radio ein Gospel, Ray albert herum, ersetzt im Text des Kirchenlieds „Gott“ durch eine Frau, fügt noch einige Stöhner dazu und schon löst der daraus resultierende Song heftige Kontroversen aus. „Großes Mädchen ich lo-obe dich, Baby, ughn, ich preise de-ine Stärke“ … so, nur eleganter und dreckiger, muss man sich den Effekt der himmlischen Lust von „I Got A Woman“ mitten in der fahlgrauen Ära von Eisenhower und McCarthy vorstellen. Diese Verweltlichung von spirituellem Gospel durch Sex, Liebe und R’n’B wird zum Ausgangspunkt von Soul. Die Erfüllung auf Erden ist bei Ray Charles eine Frau. Aber auch die schwarzen Kirchen werden in diesen Jahren weltlich, mischen sich im beginnenden Kampf um mehr Bürgerrechte immer lauter in den Alltag ein. Pastoren und Musiker bilden de Sechziger Jahre über eine Koalition.
1962, auf dem Scheitelpunkt der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, entschließt sich Ray ein Album mit Coverversionen von Country & Western-Standards aufzunehmen. Der Studio-gerechte Nashville-Country erlebt da gerade seit einigen Jahren einen massiven Aufschwung. Sich aber als Schwarzer diese zutiefst ‚weiß’ empfundene Musik anzueignen, ist mutig und riskant – ermöglicht werden die Aufnahmen vor allem durch Rays Vertragsklausel über vollständige, künstlerische Kontrolle. Ray überblendet mit diesem Album Hautfarben, er desegregiert Musik. Das ist seine ganz persönliche Anstrengung und Leistung. Und auch sein nachhaltiger Beitrag zu Country, dem er damit Würze und so etwas wie Hippness verleiht. Fiddle und Pedal Steel Gitarren lässt er weg, neben viel R’n’B und Country ist die Platte selbst von jazzigen Big Band-Arrangements geprägt, die im Heute nach etwas seichter Americana klingen – was auch daran liegt, dass Ray selbst diese klassische Crossover-Pointe in seiner weiteren Karriere viel zu oft gebracht hat. „Modern Sounds…“ demonstriert aber darüber hinaus, dass man nur mit persönlichen Coverversionen das eigene künstlerische Profil schärfen kann. Wichtig ist dabei nur Was und Wie. Als das Album veröffentlicht wird, ist Ray Charles allerdings schon ein bekannter Musiker, der auch im weißen Mainstream mit unmaskierter schwarzer Ästhetik erfolgreich ist (was so früh nur Sam Cooke ungefähr zeitgleich gelingt). Im Vergleich zu den Revolutionären des Rock’n’Roll ist Ray Charles verzweifelter, erwachsener, von persönlichen Katastrophen gezeichnet. Er wechselt laufend zwischen Jazz, Country, Soul, Blues und Crooning. „Modern Sounds in Country and Western Music“ machte Jahrzehntelang eingeübte Grenzlinien durchlässig. Es ist eine äußerst zarte Abrissbirne von Album.
Lost in Music – Nr.37
Fela Kuti
Zombie (Barclay, 1976)

1969 markiert einen Wendepunkt für Fela Kuti. Während einer langen US-Tour lernt Fela die Ideen der militanten Black Panther kennen, er trifft zahlreiche schwarze US-Musiker und wird auf dem Höhepunkt der Black Power Bewegung mit Afrozentrismus und Panafrikanismus konfrontiert. Fela Kuti selbst kommt aus einer gebildeten nigerianischen Familie und erklärt 1970 bei seiner Rückkehr nach Nigeria in Zukunft Afrobeat zu machen. Und mit genau diesem Stil wird Fela Kuti zum wahrscheinlich bekanntesten Musiker Afrikas überhaupt.
Entwickelt und weitergedacht hat Fela Kuti Afrobeat gemeinsam mit seinem langjährigen Drummer Tony Allen. Der versteht es die lokalen, polyrhythmischen und mehrstimmigen Percussiontraditionen der nigerianischen Yoruba auf ein druckvolles, westliches Drumset zu übersetzen. So verschmelzen Jazz, Funk, High Life aus Ghana Call and Response und eine einzigartige Rhythmusarchitektur zu einem Sound, der Elemente von beiden Seiten des Atlantiks zusammenführt. Aber Afrobeat ist mehr als nur die Fusion von einigen schwarzen, transatlantischen Musikstilen: Afrobeat ist ein ganzheitlich soziales, ästhetisches und politisch revolutionäres Experiment. Denn zurück aus den USA gründet Fela Kuti eine Art Kommune mit angeschlossenem Tonstudio und Club, in der sein manchmal über 40 Leute zählendes Ensemble Afrika 70 Platz findet. Dort entsteht in langen Sessions ein ständig sprudelnder Strom von Stücken, die selten kürzer als 10 Minuten sind. Fela Kuti spielt sein Publikum in Trance und öffnet mit Improvisation und treibendem Groove ein Fenster wie Musik abseits von vermarktbaren Dreiminütern auch funktionieren kann. Vor allem aber attackiert Fela Kuti unentwegt das Establishment, die bourgeoise Oberschicht, Korruption, kolonialistische Politik, aber auch Islam und katholische Kirche und setzt sich ununterbrochen für die Entrechteten und Allerärmsten ein. Der Rolling Stone nennt ihn deshalb den gefährlichsten Musiker der Welt. Um von möglichst vielen verstanden zu werden, singt er seine beißenden Texte in einfachem, aber gewitztem Pidgin Englisch.
Afrobeat ist durch Fela Kutis unermüdliche Spiel- und Angriffslust eine höchst politische Musik geworden. Allein um die dreißig Alben in den Siebziger Jahren fügen sich zu einem System der Befreiung zusammen aus dem sich kein Track oder Album einfach herauslösen lässt. Die Songs sprengen das Radioformat. Weil Fela zudem einmal aufgenommene Stücke nicht live spielen will, bleibt ihm grössere Beachtung im Westen verwehrt. Der Song „Zombie“ aber bekämpft die nigerianische Militärdiktatur und sein Fußvolk ganz direkt. Als Reaktion wird das Gelände der Kommune von über 1000 Soldaten gestürmt und komplett niedergebrannt. Felas Mutter stirbt, Bewohner werden vergewaltigt, Fela Kuti schwer verletzt und inhaftiert. Doch er wird dadurch nicht weniger radikal. Bis zu seinem Tod erlangt Fela Kuti in Nigeria und Afrika dadurch einen Status der dem von Bob Marley gleichkommt. 1997 verfolgt sein Begräbnis eine geschätzte Million Menschen vor Ort.
Lost in Music – Nr.38
The Strokes
Is This It (RCA, 2001)

Das Debüt von The Strokes fällt 2001 in das erste Amtsjahr von George W. Bush und wird nur wenige Wochen vor den Anschlägen vom elften September veröffentlicht. Die USA befinden sich gerade in einem neokonservativen Schockzustand, als mitsamt dem New Yorker World Trade Center zusätzlich weltanschauliche Sicherheiten einstürzen. Diese historische Zäsur bereitet die Bühne für eine regressive Musikrevolte vor. The Strokes beginnen mit ihrem Debüt “Is This It” einen ästhetischen Rückzug. Und ihre Signalwirkung für Musik und Style der kommenden Jahre kann fast nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Zwar tritt schon die EP “The Modern Age” im Jänner 2001 in England Aufregung und Hysterie rund um The Strokes los, aber erst ein Jahr später erreicht das sogenannte Garage Rock Revival mit anderen “The”-Bands wie Hives, Vines und White Stripes seine größte Breitenwirkung. Die schweren, ideologischen Erschütterungen, die seit 2001 mit Turbokapitalsmus, Einschränkung der Bürgerrechte und Kulturkampfrhetorik um sich greifen, verfestigen sich zu einem gesellschaftlichen Klima, in dem bewährte Wahrnehmungsmuster und bekannte Strukturen wenigstens ein bisschen Sicherheit versprechen. Die klassische Rockband, der 3-Minuten-Song, Strophe, Refrain, aber auch zugängliche, einfach gehaltene Texte – all das sind willkommene, jahrelang eingelernte Schnittvorlagen, die bei The Strokes nun wieder hervorragend zusammen stimmen. The Strokes erzählen im Plauderton vom zwischenmenschlichen Alltag in der Großstadt, sie sind simpel, endlich wieder tanzbar, etwas schmuddelig, stecken in Röhrenjeans und haben ansonsten kein inhaltliches Programm. Ihr Debüt klingt nach Proberaum und einer Zeit vor dem Synthesizer. Aufgenommen und produziert wurde “Is This It” gezielt einfach. Seine drahtigen Bässe und sein mittiger Sound kann sich auch mit dünnwandigen MP3s und billigen Computerboxen fast verlustfrei im Netz ausbreiten. Die sich gerade rapide wandelnde Musiktechnologie ist für angezerrten Garagenrock – und damit “This Is It” im Speziellen – bestens geeignet; während subsonische Klangexperimente und audiophiler Rock von frühen MP3s zerdrückt werden.
Mit dem New Yorker Quintett dringt Indierock zunehmend in den Mainstream vor. The Strokes treten in großen Talkshows und als Headliner schwergewichtiger Festivals auf. Blogs sind die neuen Hype Maschinen, die Indiebands jene virale Aufmerksamkeit zunehmend auch in den etablierten Massenmedien geben, die Marketingbudgets für große Popacts früher erzeugt haben. Insofern markiert “Is This It” wie kein anderes Album einen Bruch auf fast allen Ebenen mit der Musik der Neunziger Jahre. The Strokes sind der Sound der Scholle.
Lost in Music – Nr.47
Kruder & Dorfmeister
K&D Sessions (Studio !K7, 1998)
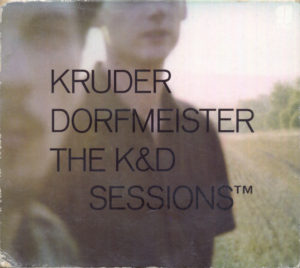
Kurz bevor Downtempo endgültig in die Belanglosigkeit abtaucht, zeigen Peter Kruder und Richard Dorfmeister mit den „K&D Sessions“ noch einmal alle Stärken kunstvoll zerdehnter Zeit auf. Ab 1991 waren TripHop und Downtempo explodiert, wurden aber bald austauschbar und waren auf dem Weg vom Club in die Design-Cafes und Fahrstühle. Das Wiener Duo rettet Downtempo vor seinen Seichtgebieten, balanciert auf dem schmalen Grat zwischen Coolness, Eleganz und dressiertem Nichts. 1994 verwenden Kruder & Dorfmeister für ihre Debüt-EP „G-Stoned“ – in elektronischer Musik Tabu – ihre bürgerlichen Namen und klatschen ihre Gesichter kokett aufs Cover. Ihre Pose zitiert dabei ein Album von Simon & Garfunkel und inszeniert das Duo als feinsinnige Personality-Songwriter des Samplings. Über das britische Magazin Straight No Chaser – nebenbei das Zentralorgan von gelecktem Acid Jazz – werden sie international schnell bekannt, ihr makelloser Sound ist da bereits abgesteckt. 1996 gelingt ihnen mit ihrer „DJ Kicks“ einer der relevantesten DJ-Mixes der Neunziger, bis sie schließlich zwei Jahre darauf mit den „K&D Sessions“ demonstrieren, wie weit sich sowohl Mix wie auch Remix als eigenständige Kunstformen entwickelt haben. Auf zwei CDs schaffen sie Verbindungslinien und sanfte Überblendungen zwischen ihren eigenen, aufwändig gemischten, aber mühelos fließenden Remixarbeiten.
Möglich wird das delikate Remixing auch durch billigere und verbesserte Samplingtechniken. Speziell die Firma Akai macht auf ihren Samplern seit Mitte der Achtziger immer neue Funktionen, immer mehr Speicherplatz verfügbar. Seit 1991 müssten allerdings die Rechte an längeren Samples geklärt werden; das Wühlen in Plattenkisten nach obskuren, quasi rechtefreien Samples wird spätestens da zu einer Königsdisziplin. Kruder & Dorfmeister sind nun sicher nicht die ersten, die so arbeiten, aber wenige beherrschen diese Techniken derart virtuos. Allein der Klang der „K&D Sessions“ klingt heute keine Spur angestaubt. Sampling ist dabei eine Kulturtechnik um sich auf das symbolische Kapital des Originalssongs zu beziehen. Hip Hop, Jazz, Dub, Bossa Nova, Drum n’ Bass und Funk werden bei Kruder & Dorfmeister allerdings eher auf neutralem Boden miteinander versöhnt, werden mit Zurückhaltung zu einem supranationalen Gebilde collagiert. Ihre Heimatstadt Wien ist nicht nur UNO-Standort seit 1980, sondern seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 auch wieder ein Knotenpunkt kultureller Transformationen. Kruder & Dorfmeister betonen immer wieder die Bedeutung Wiens für ihre Musik, behaupten, dass sie in der Tradition von Schubert und Mozart stehen würden und schüren selbst die Klischees von Kaffeehaus-Gemütlichkeit. Mit etwas selbstgemachter Standortpromotion bringt ihre Musik allerdings wirklich erstmals wieder Wien an die Welt heran. Vor allem aber befreien sie Downtempo von allem unnötigen Ballast, verbinden stilsicher das Dunkle und das Weiche mit einer blockfreien Stil-Melange.
Lost in Music – Nr.50
Little Richard
Here’s Little Richard (Speciality Records, 1957)

Bringt eure Kinder in Sicherheit, und eure Moral, hier kommt Little Richard! Ein schwer ordinäres und hysterisches Gurgeln schmettert einem da vom ersten Ton an entgegen – die Stimme jauchzt und kieckst, kreischt und plärrt. Grauslig, primitiv, und gerade deswegen so anziehend. Wer findet, dass ein brünftiger Schafsbock schöner singt als ein Zaunkönig, der zeigt auf. Ja? Dann bist du bei Little Richard richtig. Nik Cohn hat diese Musik als Nicht-Songs bezeichnet, ohne Melodie, ohne Text. Doch das wäre ungerecht, es geht immerhin auch um Sex und Hedonismus. Die Textzeile „Tutti Frutti / Good booty / If it don’t fit, don’t force it / You can grease it, make it easy” können die Produzenten des schwulen Little Richard gerade noch verhindern. Die Fünfziger Jahre sind in den USA noch nicht bereit für Analsex. Dabei singt er mit so viel Inbrunst und Feuer, dass man glaubt einen Gospel zu Ehren körperlicher Lust zu hören. Schweinepriester, selten war das Wort so passend. Später gilt Little Richard mit dieser Verschränkung zweier Welten auch als Wegbereiter von Soul und Funk. Ebenfalls bahnbrechend ist Richards Bühnenauftritt, bei dem er Travestie-Elemente in den Mainstream einführt wie das Jahrzehnte lang niemandem sonst ohne mittelschwere Sanktionen gelingt.
1955 bricht Rock’n’Roll, eine ehemalige Slangbezeichnung fürs Ficken und rhythmische Bewegungen aller Art, in den Mainstream durch. Die Musik dazu gibt es eigentlich schon längst. Neu ist allerdings, dass schwarzer Ryhthm And Blues jetzt für weiße Jugendliche vermarktet und diese ganz gezielt als Käuferschicht erschlossen wird. Auf billigen Kofferradios fährt der Rock’n’Roll quer durch das Land. Er wird in Alan Freeds Radiosendung zum Dachbegriff für eine wilde Mischung aus schwarzen und zunehmend weniger schwarzen Stilen. Die traditionelle Musikindustrie versucht nämlich in der Zwischenzeit ihre Marktanteile zu halten, gezähmte Coverversionen der Originale an die Jugend zu bringen und den neuen Stil gezielt auszubeuten. Elvis Presley und Buddy Holly bleiben immerhin den schweren Schlägen und zügellosen Shoutings ihrer Vorbilder treu. Ein ganzes Apartheidssystem bröckelt da schon. Little Richard platzt in diese Verhältnisse mit ungebremster Intensität, mit exaltiertem Auftreten und enormer Lebenslust. Er ist einer der allerersten schwarzen Performer, die für seine Fans gar nicht schwarz genug klingen kann.
Und eigentlich ist genau das das ganz große Versprechen von Popmusik, Mauern einreißen, Spiegel und Motor sozialer Veränderungen sein. Little Richard tat das so laut er nur konnte, als Clown und Hofnarr hat er sich Freiheiten geschaffen, innerhalb derer er. Genau hier ist das passiert, wozu Musik nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen fähig ist. Hier ist sie; nichts weniger als eine Revolution.
Besprochene Alben:
1930
25 Billie Holiday – The Commodore Master Takes (1939)
1950
19 Bill Monroe – Blue Grass 1950-1958
06 Bing Crosby – A Musical Autobiography (1954)
01 Jerry Lee Lewis – Jerry Lee Lewis (1957)
50 Little Richard – Here’s Little Richard (1957)
27 Bo Diddley – Bo Diddley (1959)
1960
14 James Brown – Live At The Apollo (1962)
34 Ray Charles – Modern Sounds in Country And Western Music (1962)
32 The Ronettes – Presenting The Fabolous Featuring Veronica (1963)
22 Kinks – Something Else By The Kinks (1967)
17 The Zombies – Odessey And Oracle (1968)
41 Sly & The Family Stone – Stand! (1969)
46 King Crimson – In The Court of the Crimson King (1969)
35 The Band – The Band (1969)
1970
03 Curis Mayfield – Curtis (1970)
21 Can – Tago Mago (1971)
10 Led Zeppelin – IV (1971)
12 Serge Gainsbourg – L’Histoire De Melody Nelson (1971)
48 David Bowie – The Rise Of Ziggy Stardust (1972)
43 Patti Smith – Horses (1975)
37 Fela Kuti – Zombie (1976)
05 Jonathan Richman – Roadrunner (1976)
30 Brian Eno – Music For Airports (1978)
28 Bee Gees – Saturday Night Fever OST (1978)
24 The Clash – London Calling (1979)
1980
09 Joy Division – Closer (1980)
33 Gang Of Four – Entertainment! (1982)
07 Grandmaster Flash and the Furious Five – The Message (1982)
18 Kate Bush – Hounds Of Love (1985)
40 Prefab Sprout – Steve McQueen (1985)
29 Slayer – Reign In Blood (1986)
45 Dinosaur Jr – You’re living all over me (1987)
08 New Kids On The Block – Hanging Tough (1988)
16 Public Enemy – It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back (1988)
1990
20 My Bloody Valentine – Loveless (1991)
31 Bikini Kill – Pussy Whipped (1993)
04 DJ Pierre – DJ Pierre (1994)
13 Blumfeld – L’Etat Et Moi (1994)
42 Blur – Parklife (1994)
44 The Notorious B.I.G. – Ready To Die (1994)
39 Daft Punk – Homework (1997)
02 Fennesz – Hotel Paral.lel (1997)
23 Missy Elliot – Supa Dupa Fly (1997)
47 Kruder Dorfmeister – K&D Sessions (1998)
2000
38 The Strokes – Is This It (2001)
26 Michael Mayer – Immer (2002)
15 Wilco – Yankee Hotel Foxtrott (2002)
36 Dizzee Rascal – Boy In Da Corner (2003)
11 M.I.A – Aurular (2005)
49 Vampire Weekend – Vampire Weekend (2008)




